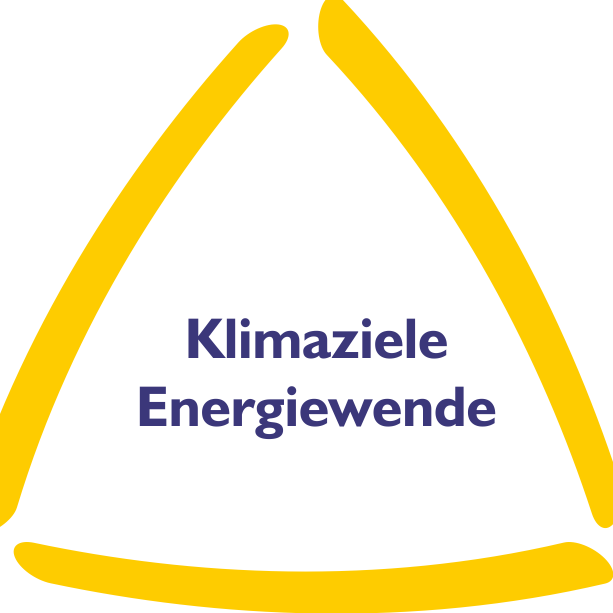Solarworld, Q-Cells oder Conergy: Unter anderem diese deutschen Solarfirmen gehörten zu den Pionieren des deutschen PV-Booms, inzwischen sind sie verschwunden. In den Nuller-Jahren produzierte Deutschland mehr Solarzellen als jedes andere Land der Welt und schuf innovatives Know-how.
Dann traten Chinas Solarhersteller auf den Plan. Dank Staatssubventionen boten sie ihre PV-Komponenten weltweit zu unschlagbaren Preisen an. Deutschland und die EU konterten damals nicht mit Hilfen für den Sektor, die deutsche Solar-Förderung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz wurde gekürzt. Damit setzte sich der aufstrebende globale PV-Zug ohne Deutschland in Fahrt.
„China hat über 50 Milliarden US-Dollar in neue Photovoltaik-Lieferkapazitäten investiert – zehnmal mehr als Europa – und seit 2011 mehr als 300 000 Arbeitsplätze in der gesamten Wertschöpfungskette der Photovoltaik geschaffen“, schreibt die Internationale Energie-Agentur IEA.
Bei Wafern (dünnen Siliziumscheiben für PV-Module) liegt Chinas Weltmarktanteil bei 97 Prozent. „Dies hat über die vergangenen fünf bis sechs Jahre dazu geführt, dass sich auch alles Umgebende – also Gerätschaften oder Verbrauchsmaterialien – in China ansiedelte und nun zu ähnlich hohen Prozentsätzen von dort stammt wie die Wafer selbst“, sagt Jochen Rentsch, Solarexperte am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE).
China ist ein autokratischer Staat, der über Exportbeschränkungen seine Marktmacht ausspielen könnte. Peking erwägt bereits, die Ausfuhr von Solartechnologie zu erschweren. Ein Gesetzgebungsverfahren ist im Gange, das ausländische Käufer in komplizierte Genehmigungsverfahren für zahlreiche Produkte zwingen würde, vom Wafer bis zur Produktionsmaschine für Solaranlagen. Ob das Gesetz so in Kraft tritt, ist noch offen.
Nun will die EU eine eigene Solarindustrie aufbauen. EU-Politiker und europäische Photovoltaik-Hersteller haben im Dezember 2022 eine Initiative namens „Solar PV Industry Alliance“ gegründet, die bis 2025 eine Photovoltaik-Produktionskapazität von 30 Gigawatt in Europa aufbauen will, und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das wäre das Sechsfache der heutigen Kapazität. Die neue Allianz soll mithilfe eines Solarfonds bei der Finanzierung helfen.
„Wichtig ist es, günstige Voraussetzungen zu schaffen“, sagt Jochen Rentsch. „Das hat die EU bereits angestoßen, indem sie zugelassen hat, dass die Mitgliedstaaten Unternehmen der Energiewende-Technologien gezielt fördern dürfen. Das verbietet normalerweise das Wettbewerbsrecht der EU. Die Mitgliedsstaaten können dafür zum Beispiel Gelder aus dem Green Deal-Topf verwenden. Auch können sie mithilfe von gezielter Standortförderung versuchen, Industriecluster anzulegen.“
Das könnte der Energiewende und dem Klimaschutz einen Schub in eine stabilere Richtung geben. Besonders kommunale Akteure können mit der Ansiedlung von PV-Unternehmen an ihrem Wirtschaftsstandort sehr profitieren und viele positive Synergieeffekte schaffen.